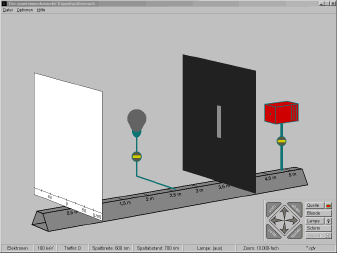Allgemeines
Das Simulationsprogramm  Quantenmechanischer Doppelspaltversuch wurde am Lehrstuhl für Didaktik der Physik an der LMU München von K. Muthsam entwickelt und kann von dort unter Fundgrube/Downloads/Doppelspalt kostenlos heruntergeladen werden.
Quantenmechanischer Doppelspaltversuch wurde am Lehrstuhl für Didaktik der Physik an der LMU München von K. Muthsam entwickelt und kann von dort unter Fundgrube/Downloads/Doppelspalt kostenlos heruntergeladen werden.
Kurzbeschreibung
- Interaktives Labor zur Interferenz von Photonen, Elektronen, Protonen, Neutronen und klassischen Teilchen am Einfach- und Doppelspalt in deutscher, englischer, spanischer, türkischer und schwedischer Sprache.
- Variation der Parameter Teichenenergie, Spaltbreite und Spaltabstand
- Beobachtung des Interferenzmusters zu beliebigen Zeitpunkten mit wählbarer Vergrößerung und Vergleichsmöglichkeit mit theoretischem Intensitätsverlauf.
- Speicherung des Versuchs mit Versuchsergebnissen
- Programm enthält Version mit Lehrgang zum Thema
Lehrplanbezug
- Das Verhalten von freien Elektronen und Protonen am Doppelspalt ist im Lehrplanbaustein Mikroobjekte I für Grund- und Leistungskurs verpflichtend vorgesehen.
Vorkenntnisse der Schüler
- Beugung am Spalt und Doppelspalt (Huygenssches Prinzip, Beugung, Interferenz)
- De Broglie - Welle
- Theorie der Zustandsvektoren
- Wahrscheinlichkeitsfunktion
- Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation (Erarbeitung gegebenenfalls innerhalb des Lehrgangs)
Lehrgangsbeschreibung und Unterrichtseinsatz
Lehrgangsbeschreibung
Nach Programmstart erscheint der virtueller Zwerg "Quantus". Er stellt den Anwender vor die Wahl ohne Hilfestellung frei mit der Versuchsanordnung zu experimentieren oder sich seiner Führung durch den Lehrgang anzuvertrauen:
Den Lehrgang beginnt Quantus mit der Analyse des Doppelspaltversuchs mit klassischen Teilchen. Spaltbreite und Spaltabstand sind einzustellen, betätigt man den Anschaltknopf der Quelle, wird der Doppelspalt mit einem Farbspray beschossen. Quantus stellt die verschiedenen Darbietungsmöglichkeiten der in alle Richtungen dreh- und wendbaren Anlage vor: "Durchführung"/"theoretischer Verlauf"/"Auswertung". Die Option "Auswertung" gestattet dem Anwender nach der Durchführung eines Experimentes, die Anzahl der auf dem Projektionsschirm auf Parallelen zur y-Achse eingeschlagenen Teilchen aufzusummieren.
Im zweiten Teil des Lehrgangs wird der Doppelspaltversuch von Jönsson zur Elektronenbeugung durchgeführt und diskutiert. Quantus stellt dem Anwender an einigen Stellen Ja-Nein-Fragen, deren Beantwortung den weiteren Lehrgangsverlauf steuern. Quantus erzählt auf Anfrage von den Realisierungsproblemen des Jönsson-Experiments von 1960 und deren Lösung, die vollständig jedoch nur mit chemischer Vorbildung verstanden werden können. Nach der Versuchsdurchführung erläutert Quantus die Grundlagen der quantenmechanischen Deutung des Versuches nach DeBroglie und Born: Dem Elektron wird eine Wellenlänge und Wellenfunktion zugeordnet, die sich als Lösung der Schrödingergleichung ergibt. Das Quadrat der resultierenden Wellenfunktion gibt die Auftreffwahrscheinlichkeit der Elektronen auf dem Projektionsschirm an.
Im dritten Teil des Lehrgangs stellt es Quantus dem Anwender frei Beugungsexperimente mit anderen Teichenarten durchzuführen oder sich bereits jetzt mit weiteren Eigenschaften der Quantenobjekte zu beschäftigen. Die Atombeugung erläutert Quantus am Beispiel der Heliuminterferenz. Er informiert den Anwender von Details der Realisierung dieses Experimentes an der Universität Konstanz im Jahre 1991. Die Erläuterungen sind allerdings ohne entsprechendes Vorwissen nicht zu verstehen.
Im vierten Teil des Lehrgangs wird das Fehlen der klassischen Eigenschaften "Ort" und "Impuls" bei Quantenobjekten in Form eines interaktiven Frage- Antwort-Spiels diskutiert. Ausgangspunkt ist die Frage, ob es sich bei einem Quantenobjekt nun um ein Teilchen oder eine Welle handelt. Die Wellen-Annahme wird aufgrund diskreter Auftrefforte verworfen. Wenn, so Quantus, Quantenobjekte aber Teilchen sind, dann müsste es egal sein, ob zunächst nur ein Spalt mit der Hälfte der Teilchen und dann der andere mit der zweiten Hälfte beschossen wird. Die experimentelle Überprüfung ergibt jedoch kein Interferenzmuster mehr. Die Gesamtintensität ist also nicht wie bei klassischen Teilchen gleich der Summe der Teilintensitäten. Die Teilchen können sich also zwangsläufig nicht vor einem der beiden Spalte befunden haben und verlieren dadurch die Eigenschaft der exakten Ortsbestimmbarkeit.
Im letzten Teil des Lehrgangs wird die Ortsbestimmung von Teilchen genauer untersucht. Der Bereich hinter dem Doppelspalt mit den Photonen einer Lampe beschossen. Trifft ein Photon auf ein Elektron, so gibt es einen Blitz. Somit ist der exakte Ort des Elektrons bestimmt. Wellenlänge und Intensität der Lampe sind prinzipiell frei wählbar, werden von Quantus an dieser Stelle jedoch vorgegeben. Mit blauem Licht stellt der verblüffte Anwender fest, dass das beobachtete Interferenzmuster verschwindet. Der kleinen Wellenlänge ist ein zu großer Impuls zugeordnet, sodass die Elektronen hinter dem Spalt sozusagen aus ihrer Bahn gekickt werden und zu einem geordneten Interferenzbild nicht mehr beitragen können. Quantus lässt die Wellenlänge der Lampenphotonen vergrößern. Das Interferenzbild bleibt, doch treten nun verstärkt Beugungseffekte auf. Eine exakte Ortsmessung unter Beibehaltung der Interferenzfähigkeit ist also wieder nicht möglich. An dieser Stelle ist Quantus bei der Heisenbergschen Unschärferelation angelangt.
Unterrichtseinsatz
Das Programm kann in folgender Weise im Unterricht eingesetzt werden
- Klassischer Unterricht: Elektronenbeugung an Graphitfolie und Einführung der De Broglie - Wellenlänge, Aufgabe die Wellenlänge von anderen Teilchen zu berechnen
- Programm ohne Lehrgang: Überprüfung der Berechnungsergebnisse mit dem Programm, dient gleichzeitig der Einarbeitung ins Programm
- Programm mit Lehrgang: Schüler arbeiten selbstständig mit Lehrgang. und notieren offene Fragen. Durch das wechselweise Experimentieren und Studieren der Kommentare des Quantus ist eine intensive Auseinandersetzung mit einigen Wesenszügen der Quantentheorie möglich. Fragen werden im Plenum diskutiert.
![]() Quantenmechanischer Doppelspaltversuch wurde am Lehrstuhl für Didaktik der Physik an der LMU München von K. Muthsam entwickelt und kann von dort unter Fundgrube/Downloads/Doppelspalt kostenlos heruntergeladen werden.
Quantenmechanischer Doppelspaltversuch wurde am Lehrstuhl für Didaktik der Physik an der LMU München von K. Muthsam entwickelt und kann von dort unter Fundgrube/Downloads/Doppelspalt kostenlos heruntergeladen werden.